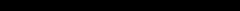mit chris dercon © andreas pein, faz
berlin, 20. dezember 2016
unser theater soll eine schule des befremdens sein
gespräch mit marietta piekenbrock und chris dercon über die volksbühne
geführt von jürgen kaube, kolja reichert und simon strauß
Interview mit Marietta Piekenbrock und Chris Dercon aus der FAZ vom 20.12.2016
Hätte sich die designierte, schon heftig angefeindete Volksbühnen-Spitze
den Ärger nicht ersparen und einfach ihre konkreten Pläne bekanntgeben können? Hier, im ersten Interview, tut sie es.
Herr Dercon, Sie sind in den letzten Monaten und Wochen so heftig beschimpft worden wie kein anderer designierter
Intendant seit langem. Wenn Sie die Volksbühne besichtigen wollen, müssen Sie mit Frank Castorfs Anwalt verhandeln.
Auf einem Empfang wurde Ihnen Bier über den Kopf geschüttet. Kurz sah es so aus, als würde die neue Stadtregierung
Ihre Berufung rückgängig machen wollen. Fühlen Sie sich hier in Berlin inzwischen wie ein Klassenfeind?
Chris Dercon
Nein. Aber dass es nicht einfach werden würde, das wusste ich von Anfang an. Ein Museumsmann an einem Theater –
das ist nicht einfach für alle Beteiligten. Ich hätte das Angebot auch nie angenommen, wenn ich in meinem Leben nicht viel mit
Theater zu tun gehabt hätte. Während meines Studiums war ich oft im Studententheater der katholischen Universität Löwen und
damit bei der Geburtsstunde des neuen belgischen Theaters dabei. Künstler wie Anna Teresa de Keersmaeker und Meg Stuart
machten in Brüssel ihre ersten Schritte. Ich habe dann auch viel Zeit am Kaaitheater in Brüssel verbracht, das sich schon
sehr früh internationalisierte. Meine ersten Ausstellungen habe ich im Rahmen von Theater- und Tanzinstitutionen realisiert
und war eine Zeit lang wöchentlich im Mickery Theatre in Amsterdam. Was ich da gesehen habe, ist für mich immer noch eine
unglaubliche Inspirationsquelle. Ich hatte während meiner Karriere als Museumsleiter immer wieder Lust, etwas mit Theater zu machen.
Auch in der Tate Modern haben wir das ja immer wieder versucht.
Die Tate Modern hat sich mit der Turbine Hall in der Tat sehr früh für performative Formen geöffnet.
Was kann das Museum, was das Theater nicht kann?
CD
Museen werden immer mehr zu Begegnungsorten. Gleichzeitig gibt es in der Theater- und Tanzwelt,
auch der Musik, mehr und mehr den Wunsch, sich den temporalen und räumlichen Konventionen zu entziehen.
Ein Museum kann das theoretisch möglich machen. Da kann eine Performance um acht Uhr morgens anfangen und zwei Tage und Nächte dauern.
Und was kann das Theater, was das Museum nicht kann?
CD
Das Museum hat nicht die Technik und die Programmatik und auch nicht die Mittel, die zum Beispiel ein Theater wie die Volksbühne hat. Da geht es nicht nur um Menschen, sondern auch um Technik, Beleuchtung, Werkstätten. Die Bildende Kunst findet immer wieder neue Tricks, um die Kunst noch weiter durchzuökonomisieren. Im Theater ist nothing for sale. Man kann es nicht besitzen und wenn, dann als geistigen Besitz, als gemeinschaftlichen Besitz – das interessiert mich am Theater.
Frau Piekenbrock, Sie haben die renommierte Ruhrtriennale und andere erfolgreiche Festivalformate entwickelt.
Jetzt werden Sie Programmdirektorin eines Stadttheaters, das bisher den Ensemblegedanken hochgehalten,
im Repertoire produziert und kein Festivaltheater gemacht hat. Was wird sich daran von September 2017 an ändern?
Marietta Piekenbrock
Wir haben uns zu Beginn in den Gesprächen mit den Künstlern die Frage gestellt:
Gibt es in zwanzig Jahren überhaupt noch diese Art der Spartenhäuser?
Ein Haus für die Oper, ein Haus für das Theater, ein Museum für die bildende Kunst, für die Philharmonie, ein Kino für den Film?
Es sind nicht unbedingt immer die Festivalleiter oder Kuratoren, die dafür sorgen, dass das Museum tanzt, der Tanz spricht,
das Schauspiel sich auf der Leinwand verdoppelt oder das Kino den Bühnenraum betritt. Das sind alles Formen, mit denen die
Künstler offenbar etwas vorbereiten, von dem wir noch gar nicht wissen, was das in Zukunft sein wird. Vielleicht eine
Metastruktur, der Superapparat, der alle Formen in sich aufnimmt und transzendiert. Das hat in unserer Programmplanung
eine große Rolle gespielt. Das heißt nicht, dass alles notwendig immer in einem Œuvre zusammenkommt. Die Volksbühne wird
unter unserer Leitung ein Haus sein, das all diese Rezeptionsformen empfangen und vor allem auch produzieren kann. Mit
ihren berühmten Werkstätten bildet sie ein Biotop, das eine Traumfabrik für Künstler sein wird, die hierherkommen.
Es soll ein utopischer Ort werden, an dem die Künstler realisieren können, was sie sich einfallen lassen. Hier gibt
es Werkstätten, Probenräume, Ingenieure, die Dinge erfinden können. Da ist eine ganze Infrastruktur an Gewerken. Wenn
sie wollten, könnten die Künstler hier sogar Ritterspiele inszenieren.
Ritterspiele in der Volksbühne – darauf freuen wir uns...
MP
Wir wollen die Volksbühne nicht wie ein Museum und auch nicht wie ein Festival
programmieren, sondern als eine Art Stadttheater ohne Grenzen, das sich in Berlin sehr stark verankert
und vor allem Künstler aus Berlin, aber auch nach Berlin einladen möchte, hier zu arbeiten. Es gibt so
viele Künstler, die aus verschiedenen Gründen hierhergekommen oder geflohen sind, großartige Kunst machen,
aber nirgendwo angedockt sind: Francis Kéré, Ari Benjamin Meyers oder Calla Henkel und Max Pitegoff sind nur
wenige Beispiele für Künstler, die in Berlin leben, aber nirgendwo fest angedockt sind. Wir wollen, dass
sie bei uns eine Heimat finden.
Ein Ensemble aus Architekten, Choreographen und Bildenden Künstlern? Wo bleiben die Schauspieler?
CD
Wir werden nicht nur Schauspieler, sondern auch Künstler an unser Haus binden. Diese Künstler
werden mit uns über einen Zeitraum von fünf Jahren zusammenarbeiten und das Repertoire gestalten. Sie
werden regelmäßig und vor allem mit unkonventionell langen Probezeiten, also besseren Bedingungen als
andernorts, bei uns arbeiten können. Um die zu schaffen, werden wir viele Kollaborationen eingehen;
alleine ist vieles nicht möglich, zusammen schon. Ich habe mein ganzes Leben lang in Kollaborationen
gedacht und gearbeitet. Deshalb habe ich auch ein Problem mit dem deutschen Wort „Alleinstellungsmerkmal“:
Für mich hat das vor allem einen negativen Beiklang.
Das ist natürlich eine Museumslogik: Kollaborationen, internationale Netzwerke...
CD
Nein, gar nicht. Das Festival d’automne arbeitet zusammen mit dem Palais de Tokyo,
dort hat Tino Seghal an der L’opera de Paris inszeniert. Überall vernetzen sich Kulturinstitutionen
miteinander, um effektiver zu sein.
Vernetzung, Kooperation – das sind für sich ja erst einmal nur Leerformeln.
Es kommt ja darauf an, wie man das jeweils tut. Die Volksbühne hat bisher vor allem aus sich selbst geschöpft.
Haben Sie kein Verständnis dafür, dass man sich in Berlin gegen einen solchen Vernetzungsimperativ wehrt?
CD
Nein, gar nicht. Denn auch klassische Theaterproduktionen sind ja mittlerweile überall auf
Gastspielreisen und touren um die Welt.
Normalerweise präsentieren neue künstlerische Leitungsteams ihr Programm,
indem sie Regisseure nennen oder zumindest eine grobe inhaltliche Ausrichtung des Spielplans vorgeben.
Haben Sie so etwas überhaupt, oder geht es Ihnen nur um die Organisation, die Formfragen?
MP
Doch, wir haben ein Programm! Allerdings hat es kein Feindbild, es kennt keine Himmelsrichtung,
ist nicht ideologisch durchleuchtet, sondern radikal subjektiv. Wir haben die Volksbühne als ein Haus für die Künstler konzipiert;
deshalb ist es unmöglich, sie alle unter ein dominantes Spielzeitmotto zu pferchen. Besonders ist natürlich, dass wir vor
einem Haus stehen werden, das völlig leer ist. Wir haben ja keinerlei Repertoire, auf dem wir aufbauen könnten, und müssen alles neu erfinden.
Wir wollen die Volksbühne auf zwei Säulen stellen und gewissermaßen wie ein Museum einrichten, mit Räumen, die der Gegenwart, und
Räumen, die der klassischen Moderne gewidmet sind. Einerseits haben wir mit der Theaterregisseurin Susanne Kennedy,
dem Choreographen Boris Charmatz, dem Filmemacher Romuald Karmakar und der Choreographin Mette Ingvartsen vier Künstler,
die bei uns Uraufführungen machen und uns zusätzlich auch frühere Arbeiten, die sie in ihrem persönlichen Repertoire
haben, mitbringen werden. Sie verkörpern gewissermaßen das Neue, sind die Repräsentanten des 21. Jahrhundert.
Und die zweite Säule?
MP
Daneben wollen wir uns auch der unmittelbaren Vergangenheit zuwenden. Hier in Berlin Mitte befinden wir uns
im Epizentrum der Gegenwartskunst. Überall begegnen wir der kultischen Verehrung des Neuen, die oft mit einem Verlust des
Gestern einhergeht. Dagegen wollen wir uns explizit positionieren, indem wir fragen, welche Positionen der klassischen
Avantgarde für unsere Künstler und für unser Publikum eine besondere Rolle spielen könnten. Wir wollen also den Begriff
„Repertoire“, dessen wörtliche Bedeutung ja Fundstätte ist, so gebrauchen, dass wir ein Verzeichnis der Moderne anlegen
und untersuchen können, was relevant sein könnte für uns heute. Dafür ist natürlich viel Recherchearbeit nötig, bei der
uns Alexander Kluge hilft. Jedes Mal gilt es dann zu entscheiden, wie man ein Stück Theatergeschichte aktualisieren und
auf die Bühne bringen kann. Als Modellinszenierung, Rekonstruktion, Pasticcio oder durch eine Wiederlektüre. Insgesamt
soll unser Programm aber gekennzeichnet sein von dem Verlangen, Positionen des zwanzigsten Jahrhunderts mit denen des 21.
Jahrhunderts zu kontrastieren.
Wodurch wird sich die Volksbühne unter Ihrer Leitung von anderen Berliner Theatern wie dem HAU unterscheiden?
MP
Einerseits verstehen wir es als unseren Auftrag, durch unsere Idee von einem radical repertory den
Verlust des Gestern zu kompensieren, andererseits soll unser Theater eine Schule des Befremdens sein.
In unserer Gesellschaft geht im Moment die Komplexitätstoleranz verloren. Wenn wir in Castorfs Volksbühne gehen,
wissen wir eigentlich immer schon, was uns erwartet. Wir können mit einem bestimmten Vorverständnis ins Theater
gehen und sicher sein, dass es nicht enttäuscht wird. Ich glaube, wir müssen wieder einüben, lustvoll auf Fremdheit
zuzugehen, uns mit ihr zu konfrontieren. Das Theater kann eine Schule der Fremdheit sein, in der wir unsere Wahrnehmungsroutinen,
die so verklebt sind, wieder öffnen.
CD
Noch kurz zum Repertoire-Gedanken: Im Gegensatz zur Kunstgeschichte ist die Theatergeschichte oft sehr unterbelichtet.
Es gibt meistens keine Dokumente, keine filmische Dokumentation. Repertoire heißt für uns auch, den Versuch zu unternehmen,
Geschichte zu erzählen. Künstlerische Ansätze zurückzubringen, die wir noch nicht vollständig verdaut haben. Nehmen Sie zum
Beispiel Beckett. Ich hatte gerade erst das große Glück, das ehemalige Théâtre de Babylon in Paris zu besuchen, in dem 1953
die Premiere von „Warten auf Godot“ stattfand. Ich habe das Gefühl, dass sich in seinen Texten viel vom aktuellen Zeitgeist
spiegeln lässt. Die Frage nach Freiheit und Unfreiheit, Körper versus Technologie – das kommt da alles vor. Wir müssen Beckett
einfach nur aufs Neue einen Besuch abstatten. Ein anderer Fall ist der dreiundneunzigjährige französische Theaterregisseur
Claude Régy, dessen Trakl-Abend „Reve et Folie“ wir ins Programm nehmen werden. Wie dieser Sprachzerleger mit den Gedichten
umgeht, ist einfach phänomenal.
Wie stellen Sie sich denn das Publikum vor? Sie haben ein Haus mit achthundert Sitzen, wie wollen Sie das füllen?
Rechnen Sie nicht damit, dass das Gefälle zwischen dem, was war, und dem, was kommt, viele Stammbesucher abschrecken könnte?
CD
Carl Hegemann hat einmal gesagt, das Publikum der Volksbühne sei ein „Patchwork von Minderheiten“. Das
Publikum von Marthaler ist nicht identisch mit dem von Castorf, das von Pollesch nicht mit dem von Fritsch.
In der Spielzeit 2013/14 haben 180000 Menschen die Volksbühne besucht, von denen 66000 kamen, um ins Theater
zu gehen. Der Rest war auch in der Volksbühne, allerdings bei all den anderen Events, die hier stattfanden, im Foyer,
in den Salons, in der Kantine, im Keller. Die Volksbühne ist beim Publikum jetzt schon nicht nur wegen der Theaterarbeit
angenommen, sondern auch, weil sie ein Begegnungsort ist.
Welche Lehren ziehen Sie für sich aus dem schwierigen Start der Münchner Kammerspiele unter Matthias Lilienthal?
Da hat man ja auch ein zersplittertes Angebot für verschiedene Gruppen...
MP
Wir sehen uns nicht als soziales Labor. Wir haben nicht diese ganzen Konzepte von einem
„Theater des Widerspruchs“, einem „Theater der Weltentwürfe“. Repräsentationskritik steht nicht ganz oben auf unserer Agenda.
Sind Sie weniger politisch?
CD
Nein. Unser Programm ist voller politischer Signale; sie sind nur nicht domestiziert durch irgendein
Oberthema, durch das ich sie sofort navigieren kann. Wir interessieren uns aber für ideologische Motive und
Phänomene, zum Beispiel die heilige Kommunion zwischen Alt-Linken und neuen Hipstern.
Trotzdem, welche Lehren ziehen Sie aus dem Lilienthal-Problem?
CD
Unser Konzept unterscheidet sich sehr von dem, was Matthias macht.
Wir werden zum Beispiel viel Tanz im Programm haben, weil wir glauben, dass die Biopolitik von Tanz sehr interessant ist.
Da glaubt Lilienthal weniger dran. Generell interessiert mich Handwerk mehr als die Reaktionsgeschwindigkeit dilettantischer
Performativität. Ich bin sehr für das Handwerk. Ich empfinde Befremden, wenn Leute etwas auf der Bühne tun, bei dem ich denke:
Mensch, das können andere Leute viel besser. Da bin ich wahrscheinlich konservativ. Ich sehe gerne starke Schauspieler.
Ich sehe gerne gute Bilder.
Sie haben ja auch neulich Robert Wilson gelobt.
CD
Ich habe vor allem Becketts „Endspiel“ gelobt, das Bob am Berliner Ensemble inszeniert hat.
Ich finde „Endspiel“ von Beckett, in welcher Version auch immer, unglaublich. Aber ich bin nicht so ein Ästhet wie Bob Wilson.
Welche Rolle wird denn die Bildende Kunst in der künftigen Volksbühne spielen?
CD
Boris Charmatz, Susanne Kennedy, Mette Ingvartsen sind für mich alles „Bildende“ Künstler.
Wir haben auch René Pollesch an der Tate Modern diskutiert, weil ich glaube, dass das Publikum der
Bildenden Kunst Pollesch versteht. Ich sage nicht, dass das genuine Bildende Kunst ist, aber ich mag den
kategorischen Unterschied nicht mehr.
Bevor wir alle Begriffe aufweichen: Welche Formate wird es konkret geben? Sind Ausstellungen geplant?
MP
Nein.
Wird Susanne Kennedy zum Beispiel eigene Stücke machen oder klassisch inszenieren?
MP
Sie inszeniert. Sie hat sich für ihre Eröffnungspremiere von John Cassavetes „Opening Night“
inspirieren lassen. Im Mittelpunkt steht eine Schauspielerin, die durch ein traumatisches Erlebnis
die Kontrolle über ihren Alltag verliert und durch eine Abfolge von Fremd- und Selbstbildern taumelt,
in der Realität und Fiktion bald nicht mehr zu unterscheiden sind. Es geht um die Produktion von Rollenbildern
in inszenierten Situationen.
Das ist die Eröffnung des Schauspiel-Teils?
MP
Nein, das ist eine der Eröffnungen. Wir eröffnen über vier Monate, wir beginnen am 10. September und enden Silvester.
Sie hätten sich sicher viele Angriffe der letzten Monate ersparen können, wenn Sie sich einmal konkret zu
Inhalt und Programmatik geäußert hätten. Werden wir doch mal konkret: Wie dürfen wir uns die Eröffnungstage vorstellen?
MP
Boris Charmatz wird beginnen. Er wird über zwei Wochen choreografische Versammlungen auf dem
Tempelhofer Feld inszenieren, bei Tag und bei Nacht, und die ganze Stadtgesellschaft zu unterschiedlichen Formaten einladen.
Das Programm wird sich in drei Akten entfalten. Es geht bis an die Ränder von Tempelhof, Neukölln, Kreuzberg; wir tasten
also langsam unser neues Quartier im Süden ab. Im Anschluss daran werden wir das Satellitentheater von Francis
Keré mit Positionen aus dem Nahen Osten eröffnen. Wir werden dafür eng mit dem Arab Culture Fund zusammenarbeiten
und auf die Migrationsbewegung reagieren, die ja in Tempelhof eine sehr bildhafte Form angenommen hat. Wir werden
„Iphigenie in Aulis“ von Mohammad Alatar hier mit vierzig syrischen Frauen präsentieren. Dann beginnen wir langsam
den Scheinwerfer umzudrehen und auf unser Stammhaus zu richten.
Wie wollen Sie mit dem historischen Ballast des Hauses umgehen?
MP
Es wird sich vor allem die Tonlage verändern. Es wird nicht mehr so sehr um eine konfliktuelle,
extrovertierte Dramatik gehen, sondern eher eine Neuorientierung zu einer Dichtung, einer Verdichtung geben.
Dafür wird in unserer ersten Saison vor allem das Werk von Samuel Beckett stehen. Sein „Not I“, einen der
innovativsten Entwürfe der Theatergeschichte, werden wir als Becketts Originalinszenierung rekonstruieren.
Sein langjähriger Assistent und künstlerischer Mitarbeiter, Walter Asmus, lebt hier in Charlottenburg und
wird das machen. Auch Becketts „German Diaries“, die im Oktober zum ersten Mal auf Deutsch erscheinen,
werden eine Rolle spielen. Zusätzlich werden noch zwei weitere Soli von Beckett auf dem Programm stehen.
Bei Beckett finden wir zur Quintessenz des Sprechtheaters zurück: Die Stimme, der Körper, der Raum: diese
Elemente wollen wir ein bisschen zerlegen, um sie in den nächsten Monaten wieder zusammenzusetzen. Das ist eine Form von...
CD
...Exorzismus.
MP
Jedenfalls ein Bekenntnis zu einem „armen Theater“ und damit ein Gegenton zur beschleunigten,
expressiven Rhetorik von Castorf und Pollesch.
Wer wird an der Volksbühne noch inszenieren?
CD
Der thailändische Filmregisseur Apichatpong Weerasethakul wird bei uns arbeiten.
Auch bildende Künstler werden bei uns Regie führen. Allerdings werden wir nicht sagen: Nur,
weil du ein berühmter bildender Künstler bist, kannst du etwas bei uns machen.
MP
Wir sind auch im Gespräch mit dem katalanischen Film- und Theaterregisseur Albert
Serra, der in seinen Filmen an die Stelle einer Dramatik der Narration eine Dramatik der Präsenz setzt.
Das Theater ist eine Zeitschöpfungsmaschine. Uns interessieren Theaterregisseure, Künstler, Choreographen,
Filmemacher oder Bildende Künstler aus aller Welt, die nicht die Zeit vertreiben, sondern sie dehnen und wieder verdichten.
Ganz im Sinne Ihres Mottos „Think Global, Fuck Local“?
CD
Ach, kommen Sie, das ist der Slogan auf einer populären Postkarte des Schwulen Museums in Berlin.
Das ist eher liebevoll gemeint. Wenige haben den Humor in diesem Satz verstanden.
Die Fragen stellten Jürgen Kaube, Kolja Reichert und Simon Strauß. Quelle: F.A.Z.