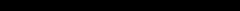susanne kennedy, regisseurin
© Doris Spiekermann-Klaas
berlin, 2. juni 2015
„das subjekt ist kein thema mehr“
susanne kennedy im gespräch
Marietta Piebenbrock
Monteverdi hat die Trennung des Liebespaares schon im Titel vollzogen.
Seine Oper heißt „Orfeo“ Opheus’ Abstieg in das Totenreich wird oft als
romantisches Motiv verklärt. Was interessiert Sie an diesem musikalischen Drama?
Susanne Kennedy
Die Wucht des Material interessiert mich. Orpheus läßt Eurydike nicht los. Sie tanzen eine Art
Limbo an der Schwelle zwischen dem Diesseits und Jenseits, den sie beide nicht beenden können.
„Orfeo“ ist eigentlich eine Übung im Sterben. Eine Vergänglichkeitsübung. Das Theater ist der
Ort, an dem wir diese Erfahrung kollektivieren können. Das geht noch weit über die Mann-Frau-Frage
hinaus. Wir können Sterblichkeit nicht akzeptieren, weder die eines anderen Menschen noch unsere eigene.
Der Tod der Frau als Tor für ein verändertes Bewusstsein ist in der Theater- und Opernliteratur des 19.
Jahrhunderts ein großes Thema. Wie viele Frauen mussten krank werden und sterben, damit die Männer etwas
erleben! Eurydikes Abwesenheit im Titel korrespondiert mit ihrer Schweigsamkeit. Man hört sie kaum,
bei Monteverdi hat nur zwei Arien! In unserer Aufführung wird sie allerdings eine sehr starke Präsenz haben.
Sie inszenieren in der Mischanlage auf der Zeche Zollverein in Essen. Ein post-industrieller
Ort mit einer machtvollen Geschichte. Welche Rolle spielt die Architektur für Ihren „Orfeo“?
Ich habe Filme im Kopf, wenn ich Theater mache. Die Guckkastenbühne gibt mir einen Rahmen, in den ich meine
Vorstellungen hineinprojizieren kann. Für „Orfeo“ durchbreche ich diesen frontal organisierten Raum. Die
Industrie-Räume wirken wie Kirchenbauten auf mich. Ihre besondere Kraft fordert eine starke Reaktion
heraus. Wir haben uns die Frage gestellt, was die Vorstellung von einer Unterwelt heute und an diesem
besonderen Ort bedeuten könnte. Vielleicht müssen wir uns von unseren Schaurigkeits-Klischees verabschieden?
Vielleicht ist das Reich der Toten eine Parallelwelt, die existiert, ohne dass sie sich also solche zu
erkennen gibt? So sind wir auf eine Ready-made-Welt gekommen, deren Module, an die billige, amerikanische
Fertigbauweise erinnern: Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Hobbyraum plus Garten.
Wo befindet sich der Zuschauer?
Insgesamt dauert die Aufführung zehn Stunden. Die Zuschauer bewegen sich in Gruppen durch einen zeitlich
begrenzten Parcours von Räumen. Am Ende wird jeder Zuschauer nur einen Ausschnitt gesehen haben.
Keine Vorstellung wird der anderen gleichen, keine wird reproduzierbar sein. Die Mischanlage auf
Zollverein ist wie ein Labyrinth, in dem der Zuschauer die Orientierung verliert wie Orpheus auf
seinem Weg in die Unterwelt.
Was bedeutet das für Ihre Rolle als Regisseurin?
Normalerweise treffe ich eine Entscheidung für jedes Details. Jeder Sound, jedes Bild, jedes Kostüm,
jede Bewegung, jede Minute wird von mir und meinem Team genau definiert. Das ist in diesem Set nicht
möglich. Ich kann weder die gesamte Spieldauer inszenieren, noch die Zuschauer choreografieren. Ich
sehe mich eher als Teil einer Landschaft, die ich gestalten, aber nicht mehr vollständig kontrollieren kann.
In Marie-Luise Fleißers „Fegefeuer in Ingolstadt“ haben Sie den kleinstädtischen Alltag in einer Bühnenbox
spielen lassen, in der die Schauspieler Playback sprechen und wie in einer Installation zu Skulpturen erstarren.
Das Deformierte ihrer Sprache wird nahezu körperlich sichtbar, ihre Bewegungen wirken mechanisch, objekthaft ...
Das Subjekt ist doch längst kein Thema mehr! Die Dinge, die wir mal erfunden haben, um den Menschen auf
der Bühne zu repräsentieren, greifen nicht mehr. Ein Beispiel: Unten auf der Straße streiten sich zwei
Männer. Wenn ich diese Szene eins zu eins auf eine Bühne übertrage, wäre das eine höchst absurde Szene.
Ihre Art zu sprechen, zu schweigen, sich zu bewegen, sich zu kleiden. Mein Theater ist für mich unglaublich
realistisch und keineswegs abstrakt oder absurd. Es ist eine Spiegelhalle für die Art und Weise, in der
ich mich der Realität annähere. Zugegebenermaßen entgleitet sie mir immer wieder, weil sie komplexer,
seltsamer ist, als wir sie uns einrichten möchten.
Aber neigt der Mensch nicht dazu, Beobachtungen und Erfahrungen zu interpretieren, sie zu einer stimmigen
Erzählung zu verfugen?
Offenbar ist das ein Zeichen für psychische Gesundheit, wenn man eine stimmige Geschichte entwickeln kann.
Doch Realität ist keine stimmige Erzählung, sondern eine fremde Erfahrung. Dieser Zustand ist für mich wichtig.
Ich möchte das Publikum sinnlich und intellektuell verunsichern. Ich möchte einen mentalen Raum erschaffen,
in dem wir unseren eigenen Wahrnehmungen nicht mehr trauen können.
Wie genau erzeugen Sie diesen mentalen Raum?
Ich beschäftige mich zum Beispiel seit vielen Jahren mit dem Phänomen der Stimme, dabei arbeite ich
eng mit Sounddesigners zusammen. Uns interessiert, einen Abstand zu schaffen zwischen Körper und Stimme,
zwischen dem Schauspieler und der Realität des Zuschauers. Im Grunde ist es ein filmisches Verfahren,
bei dem man die Stimme auf das Bild legt. Wir Menschen verorten eine Stimme intuitiv im Körper. Doch
plötzlich passt das Hörbild nicht mit dem zusammen, was ich auf der Bühne sehe. Der Zuschauer spürt:
Irgendwas stimmt hier nicht. Diese Dissonanz löst sogar eine körperliches Gefühl aus.
In Ihrer Performance „Hideous (Wo)men“ sprechen die Figuren schablonenhafte Sätze wie „I accept my
life for what it is“, My passion for living is overwhelming“, „Photography allows me to express my
deepest self.“. Woher stammen diese Texte?
Das sind Dialog-Fragmente aus „The Bold and the Beautiful“ eine amerikanische Daily Soap aus den 80er Jahren.
Oft bearbeite ich eine Textvorlage, schreibe eigene Texte oder montiere gefundenes Material aus Filmen
oder aus dem Internet. Für „Orfeo“ habe ich mich viel mit Blogs und Tumbler-Accounts beschäftigt, auf
denen Mädchen ihre Sprüche, Bilder und Filme posten. Das sind moderne Poesiealben in denen Teenager ihre
erotischen Fantasien ausleben und sich dafür eine Stellvertreter-Persönlichkeit geben. Diese Diskrepanz
zwischen der digitalen und analogen Persönlichkeit finde ich interessant.
Ist das Sprechen in Zitaten und Bildern für uns schon zur Regel, sind unsere Alias-Namen schon zur
zweiten Natur geworden?
Für mich sind diese Versatzstücke genauso authentisch wie das, was die Mädchen abends am Familientisch sprechen.
Das lateinische Wort für Maske lautet "persona“, abgeleitet von personare - hindurchtönen. Was wir heute
als Persönlichkeit, als das Individuelle bezeichnen, hat in dem Wort "Maske" seinen Ursprung. Eine Maske
kann also nicht nur verhüllen oder verfremden, sondern auch verstärken und hervorbringen Ich finde es zum
Beispiel hochinteressant, wie Menschen SMS schreiben. Was wäre, wenn wir diese Wort-Bild-Ensemble wieder
zurückübersetzen in eine gesprochen Sprache? Was würde passieren, wenn wir so sprechen, wie wir in unseren
Textnachrichten schreiben? Welchen Einfluss haben diese Bildsymbole und Grafiken langfristig auf die Literatur,
auf das Theater?
Vor etwa zehn Jahren schlug Antje Vollmer, damals Präsidentin des Bundestags, vor, die deutsche
Theaterlandschaft als Kulturerbe in den "Katalog der ewigen Dinge" aufzunehmen. Wie
denken Sie aus der Perspektive einer Regisseurin über diesen Satz?
Das bleibt ein attraktives Paradox. Das deutsche Stadttheater ist auf seine Art und Weise einzigartig!
Doch um etwas am Leben zu erhalten, muss man es auch in Frage stellen. Mir hat neulich jemand gesagt:
„Sie wollen das Theater abschaffen!“ Er spielte auf die Masken an, die Playback-Stimmen. Aber ich spiele
gerade deshalb mit den Elementen, die das Theater ausmachen, weil ich zum Kern des Theater zurück möchte.
Man sitzt in einem dunklen Raum, man konzentriert sich. Als Regisseur fühlt man sich wie ein Schamane, der
versucht diesen Raum zu verwandeln.
Warum hat dieses 2500-jährige Ritual bis heute seine Kraft erhalten?
Die unglaubliche Kraft dieses Rituals besteht darin, im Hier und Jetzt gemeinsam etwas zu erleben.
Wir verlangen danach, Geschichten, die wir eigentlich kennen, immer wieder aufs Neue zu sehen.
Immer wieder muss Medea ihre Kinder ermorden, immer wieder muss Hamlet sterben, immer wieder muss
Orfeo durch die Unterwelt irren. Wir haben offenbar das Bedürfnis an einem Ort zusammenzukommen, um
mitzuerleben, wie Menschen lieben, leiden, morden, sterben. Schauspieler und Tänzer sind wie Stalker,
wie Pfadfinder im Sinne von Tarkowski. Sie nehmen uns mit in einen „Raum der Wünsche“. Sie sind
ortskundig, wo wir uns fremd fühlen.
Ab Herbst 2017 werden Sie am Rosa-Luxemburg-Platz inszenieren. Chris Dercon hat eine digitale Bühne angekündigt.
Was könnte das bedeuten, wenn Zuschauer und Schauspieler nicht mehr Raum und Zeit teilen? Die Geschichte des
Theaters ist aufs Engste mit dieser Grundverabredung verknüpft.
Ich glaube, das Theater wird immer von diesen Paradoxien profitieren. Während er Vorbereitungen
zu meinen Stücken lebe ich buchstäblich im Internet. Ich sitze da und bewegen mich durch die
Gänge und Höhlen dieses digitalen Raums. Vielleicht ist Raum nicht das richtige Wort. Nennen wir es Realität.