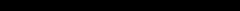boris charmatz, jahrhunderthalle bochum 2014; © ursula kaufmann
bochum, 19. juni 2014
„wir essen im liegen wir schlafen im stehen wir
verdauen die informationen wir tanzen mit vollem
mund wir singen im kauen wir kauen im gehen wir
tanzen im denken im singen im schlucken der tanz
ist gaumen der tanz ist zähne der tanz ist zunge“
boris charmatz im gespräch über „manger“
Spontane Strukturen gleiten ins Chaos, um sich im nächsten
Augenblick in wiederkehrenden Mustern neu zu formieren. Der
französische Choreograf und Tänzer Boris Charmatz konfrontiert
uns in seinen Stücken mit Skizzen der Ohnmacht, der Erniedrigung,
der Heiligkeit, der Kameradschaft und des Protests. Seine Choreografien
sind nicht Abspiegelung, Reflex des Lebens, sondern Steigerung
(ins Konfliktuelle, Extatische, Symbolische, Freiheitliche) und
Reduktion (aufs Wesentliche, Strukturelle, Intime). Dabei
unterwandert er – wie zuletzt in seinen Meisterwerken »enfant«
und »Levée des conflits« – Erwartungen und Formgesetze,
er bricht mit Routinen und arbeitet an der Ausweitung des
choreografischen und institutionellen Raums.
Auf der Bühne von Boris Charmatz herrscht häufig eine kafkaeske Dunkelheit.
Dämmriges Licht hält Hintergründe in dunklen Tönen, die auf ein Entleertsein
verweisen. Man erkennt Menschen in Bewegung und erahnt eine größere, abwesende
Ordnung. Die gebeugten Körper werden zu konkreten, skulpturalen Zeichen.
In dem Film »Levée« hellt sich die Szene auf. Die karstige Oberfläche der
Halde Haniel erscheint hier als blanke Schrifttafel, aus der die gekrümmten
Körper noch plastischer heraustreten und als Anmerkungen, als (Selbst-)
Reflexionen zu einem großen Thema lesbar werden.
Die langerwartete Uraufführung seines neuen Stücks trägt den Titel
»manger – essen«. Eine Gesellschaft von 14 Tänzern betritt das
leere Bühnenplateau, verwandelt es in einen Tisch – ohne Beine,
ohne Tuch, ohne Speisen. Es ist, als ob die Zwischenräume, die
Maschen zwischen ihnen noch enger werden und der Ausblick auf
alles, was nicht das Materielle, Funktionale und Ökonomische ist,
dabei immer schwieriger und seltener wird. Das Reflex- und Maschinenhafte triumphiert
Marietta Piebenbrock
Essen verankert uns in der Materialität,
den Tanz verbinden wir mit der Überwindung von
Schwerkraft. Das Stück konfrontiert zwei auf den
ersten Blick gegensätzliche Welten. Der banale,
sehr alltägliche Akt des Essens wurde bisher kaum
choreografisch umgesetzt. Wieso interessiert Sie das Thema Essen?
Boris Charmatz
Vielleicht interessiert es mich deshalb,
weil mir der Tanz, der die Schwerkraft zu
überwinden versucht, eher fern ist. Ich mag
den Tanz, der sich der Schwerkraft stellt,
sie in sich aufnimmt, anstatt sich ihr zu
entziehen. Die Sache ist in der Tat komplex.
Vor einiger Zeit habe ich in Hamburg in einem
Workshop mit Studierenden ein paar Dinge ausprobiert.
Dabei haben wir darüber nachgedacht, was ein mobiles Abendessen,
eine mobile Mahlzeit sein könnte. Es entstand eine regelrechte Debatte
zwischen den Workshop-Teilnehmern. Der Zusammenhang von Tanz und Magersucht
war ein Thema. Ein anderes war der Verlust von gemeinsamen Familienritualen
durch den Fernseher. Die Familien sind zersplittert, oder es fehlt ihnen an Zeit.
Man eilt zur Arbeit, isst unterwegs. Die mobile Mahlzeit erscheint mir aus
choreografischer Sicht ein gutes Format, um das gesellschaftliche Phänomen,
sich in Bewegung zu ernähren genauer zu untersuchen. Ein Phänomen, das mit
einer Verdichtung von Zeit zusammenhängt.
Ich weiß nicht, wie es sich in Deutschland verhält, aber in Frankreich
gehört es zum guten Benehmen, seinem Tischnachbarn nicht beim Essen zuzuschauen.
Es gilt als indiskret, zu beobachten, wie ein Stück Nahrung im Mund verschwindet.
Mich interessiert genau diese intime Geste, die entsteht, wenn Menschen essen,
insbesondere wenn sie auf der Bühne essen. Wenn ein Tänzer isst, zeigt er in
gewisser Weise, dass der Körper nichts Geschlossenes ist. Er zeigt, dass er sich
nicht selbst genügt. Man hat oft den Eindruck, der Körper des Tänzers brauche keine
soziale Umgebung mehr, so als wäre die Liebe schon im Körper des Tänzers, als wäre
er ein in sich geschlossenes Ökosystem. Ein Tänzer, der auf der Bühne isst, gibt zu,
dass der Tanz als ›absolutes Poem‹ nicht funktioniert.
Der Mundraum und die Lippen sind die Kontaktgrenze zwischen der Außenwelt und der Innenwelt des Körpers,
eine Art Versuchsraum, in dem Fremdes in Eigenes verwandelt wird. Ein Tänzer, der isst, lenkt die
Aufmerksamkeit des Publikums auf sein Gesicht, auf den Mund.
Den Mund zu berühren ist eine sehr intime Geste. Tänzer berühren selten ihren Mund. Das hat mit dem
Atmen zu tun: Bei starker körperlicher Anstrengung reicht die Nase nicht aus, man atmet zusätzlich vor
allem durch den Mund. Wenn man nun gleichzeitig isst, behindert man die Atmung. Es gibt eine starke
Verbindung zwischen Mund, Blick und Händen. Beim Tanzen zu essen, erfordert eine völlige Neuorganisation
des Körpers. Im weitesten Sinne geht es um das Orale: Essen, Singen, die Stimme benutzen, weiter Essen,
sich bewegen, sich bewegen aus den Essbewegungen heraus. Im klassischen Ballett sind die Münder der
Tänzer oft verkrampft. Beim Ballett herrscht das Gebot des Lächelns, selbst wenn man ›leidet‹ und
einem nicht zum Lächeln zumute ist. Eine andere Konvention ist der neutrale Gesichtsausdruck im
modernen Tanz. Bei Cunningham wird nicht gelächelt, man sieht kein lebendiges Gesicht. Eine wieder
andere Konvention ist die der Grimasse, des theatralen Gesichts. Das Essen auf der Bühne führt zu
einer weiteren Ausdrucksform des Gesichts.
Was essen die Tänzer auf der Bühne?
Zu Anfang haben wir alles Mögliche gegessen: Obst, Gemüse, Brot, Chips. Auf der Bühne etwas Konkretes zu
essen, ist ein sehr materieller Gestus. Essen wir Möhren, heißt es sofort: Das sind Tänzer, die essen nur
Gemüse. Essen wir Chips, bedeutet das Junk Food. Essen wir alles durcheinander, ist es eine Anspielung
auf die Konsum- und Überflussgesellschaft. Essen wir Tiere, Huhn, Fleisch, steht sofort die Frage im Raum:
Dürfen wir Tiere quälen? Dürfen wir sie töten?
Wir essen weiße, leere Blätter, auf die theoretisch etwas geschrieben werden kann. Ich denke an
Zeitungen, an Nachrichten oder an Arbeitsverträge. Es ist als äße man den Gesellschaftsvertrag. Ich habe
erst später erfahren, dass dieses Papier aus demselben Teig besteht wie die Hostie: Was man bei der
Kommunion den Leib Christi nennt, besteht genau aus diesem Stoff. Es wird zwar ausgestanzt und hat am
Ende eine andere Form, aber es ist dieselbe Sache. Das Blatt Papier hat sich im Laufe der Proben zu einer
Großmetapher entwickelt, deren Offenheit mir gefällt. Es transformiert den Vorgang. Er bleibt zwar
materiell in der Substanz, ist aber offener. Sieht man einen Apfel, denkt man: Aha, sie werden den Apfel
essen. Ein Blatt Papier wirft die Frage auf: Was werden sie lesen? Was werden sie tun?
Mich interessiert Essen als Metapher. Wie reagieren wir auf Realität? Mir gefällt das Bild, wie wir
vor dem Fernseher essen. Wir sehen Nachrichten aus Syrien, der Ukraine, der Türkei oder von der
Fußballweltmeisterschaft und wir essen. Wir glauben, wir essen die Chips oder das Sandwich, aber
vielleicht essen wir, um nicht weinen zu müssen. Wir essen, um die Informationen zu verdauen. Wir
essen, um nicht zu schreien.
Ist der Tanz eine materielle oder immaterielle Kunst?
Das Spannungsverhältnis zwischen dem Materiellen und dem Immateriellen beschäftigt den
zeitgenössischen Tanz im Moment sehr stark. Ist Tanz eine immaterielle Kunst, weil er
keine Skulptur ist, keine Lampe und kein Gemälde? Lässt sich Tanz sammeln oder nicht? Was ist materiell
und was ist immateriell im Tanz? Man isst, man muss bezahlt werden, man wiegt 80 Kilo. Das ist materiell.
Aus der Perspektive der Bildenden Kunst ist Tanzen immateriell: Bewegung ist immateriell. Andererseits
bestehen wir aus Geist und Materie, wir sind ungemein konkret. Wenn mir der Knöchel weh tut, kann ich
nicht springen, das ist sehr materiell (lacht), aber verglichen mit einem Tisch sind wir sehr immateriell.
Ich mache eine Geste, und sie verschwindet, sobald ich sie ausgeführt habe. Sie ist zu Ende. Wir versuchen,
sie aufzuzeichnen, aber ihre physische Erscheinungsform ist flüchtig.
Sie haben 2009 das Centre chorégraphique national in Rennes übernommen und zu einem Musée de la danse –
einem Museum für den Tanz erklärt. Was bedeuten diese Fragen zur Materialität und Immaterialität
für Ihre Arbeit als Choreograf und als Kurator?
Tanz im Museum bringt beides mit sich, eine immaterielle Dimension (nicht greifbare oder nicht dauerhafte Werke)
und eine materielle, soziale, gesellschaftliche Dimension, die aus der Präsenz der Künstler und aus den
ökonomischen und ästhetischen Bedingungen, unter denen sie arbeiten, entsteht. Dieser Spagat ist für mich
einfach inspirierend. Ich bin mir inzwischen nicht mehr ganz sicher, ob ich meine Choreografien nicht wie
Ausstellungen anlege und umgekehrt. Es ist, als hätte der mentale Raum, der meine Stücke prägt, eine klare
Ausdrucksform gefunden über den Umweg einer institutionellen Erfindung (dem Musée de la danse), aus der
zahlreiche Projekte hervorgegangen sind, nicht nur meine eigenen, sondern auch die vieler anderer Künstler.
In »Levée des conflits« drehen sich die Performer um die eigene Achse,
sie fallen mit den Armen fechtend, sie stemmen ihre Ellenbogen gegen den Boden, die Gesichter im Staub,
sie richten sich wieder auf, rudern ins Freie, dem Himmel entgegen. Es ist als führten sie zwei Bewegungen
gleichzeitig aus: eine, die in die Tiefe und eine zweite, die ins Helle, nach Oben weist. Der Film »Levée«
macht die Performance als Momentaufnahme einer Gemeinschaft lesbar, die zwischen höchster Sphäre und dunkler
Tiefe, zwischen Hybris und Zweifel, zwischen Aufbegehren und Melancholie buchstäblich rotiert. Der langsame
Aufbau des Bewegungsvokabulars bleibt immer sichtbar. Wie bei einem Fresko enthält noch das scheinbar
vollendete Werk (die Choreografie, der Film) die Spuren seiner Entstehung. Welche Rolle spielt Zeit in »manger«?
Wir versuchen, Zeit greifbar zu machen. Die Bewegungen der Tänzer sind materialisierte Zeit.
Das Stück beginnt mit Bewegungen, die die Vertikale betonen, während die weitere Choreografie sich
eher am Boden entfaltet. In unserer Gesellschaft wird an Tischen gegessen. Wenn etwas herunterfällt,
isst man es nicht mehr. Grundsätzlich gilt, was in die Nähe der Füße gerät als schmutzig.
Daneben gibt es einen, sagen wir, spirituellen Teil, in dem wir singen. Die Musik stammt aus sehr
unterschiedlichen Quellen. Eine Musik des Renaissance-Komponisten Josquin Desprez, aber auch Beats,
einige Lieder, darunter La Folia von Arcangelo Corelli. La Folia ist ein bekanntes, kleines Thema
aus dem Barock, das von vielen Komponisten bearbeitet wurde. Corelli hat davon eine berühmte Version
geschaffen. Sie ist stark zyklisch angelegt, klingt sehr schwebend und wirkt auf mich sehr spirituell.
Wir haben während der Proben immer wieder Stücke von György Ligeti und Morton Feldman gehört.
Wir sind keine Musiker, keine Sänger, aber wir versuchen, diese Hörerfahrungen in Klang zu übersetzen.
Wir hören das luftige, helle Qui habitat von Josquin Desprez, während die Körper zu Boden gehen.
Umgekehrt skandieren wir die Rufe einer Phantomdemonstration.
Es sind keine konkreten Worte wie bei einer veritablen Protestdemonstration,
sondern die reine Rhythmik der Sätze in der Gruppe. Im Gegenzug öffnen sich die Körper
ins Spirituelle. Das heißt, im Aufbau dieser Szenen tauschen Klang und Tanz die Plätze.
Die Choreografie ist im Grunde auf drei Ebenen oder anhand dreier Partituren, dreier Linien
organisiert: einer klanglichen, einer plastischen und einer rein choreografischen Bewegungs-
oder Handlungslinie. Alle drei Ebenen überlagern sich schließlich in einem einzigen Bild.
»enfant« beginnt mit einem Maschinenballett auf dunkler Bühne. Ein schwarzer Kran schwenkt über die Bühne,
eine Seilwinde schnarrt, leblose Leiber werden in die Höhe gezogen und wieder heruntergelassen. Auch die
Choreografie »Levée des conflits« gleicht in bestimmten Momenten einer Bewegungsmaschine. Arme rotieren wie
Radspeichen, einzelne Glieder verzahnen sich zu einem Knäuel. Man gewinnt den Eindruck, als würden sie
von einer fremden Macht bewegt. In »manger« wirken die Konflikte und Machtfragen introvertiert, abstrahiert.
Wir verleiben uns etwas ein. Man könnte auch sagen, wir verstoffwechseln die Realität.
Weltstoffe müssen durch den Mund ins Innere. Je schlichter, je unspektakulärer das ist,
desto mehr gefällt es mir. Augenblicklich gibt es in dem Stück nur einen Text. Darin beschreibt
der Dichter Christophe Tarkos einen Menschen, der komplett aus Scheiße besteht. Die Zunge ist aus
Scheiße, die Zähne sind aus Scheiße, die Augen und das Blut sind braun, die Gedanken sind aus Scheiße.
Der Text taucht auf, während die Tänzer essen und spricht etwas an, was sonst normalerweise ausgegrenzt
wird. Wir essen, wir verdauen, aber wir sprechen nicht von unseren Ausscheidungen. Einige unserer Tänzer
sind Ausländer, für sie ist der Text schwer zu lernen (übrigens auch für die Franzosen). Sie sagen:
»Der erste Text, den ich auf Französisch lerne, ist nicht etwa ein Chanson von Edith Piaf oder ein
Gedicht von Charles Baudelaire – der erste Text, den ich auf Französisch auswendig lerne, handelt
von Scheiße!« Der Tanz ist eine Kunst des Wandels. Und zwar nicht nur im Sinne des Butoh, in dem der
Säugling und der Greis, das Tier und der Tod getanzt werden, sondern im Sinne von Fragen: Wie verdaut
der Körper angelernte, anerzogene, stereotype Gesten und Patterns?
Pontormos schreibt dieses Affresco der Körperlichkeit am Ende seines Lebens. In seiner Selbstbeobachtung
wird Welt nahezu ausgegrenzt. Er lebte in einer Gesellschaft im Wandel, es war der Übergang von der
Hochrenaissance zum Barock, politisch eine Zeit vieler Krisen. Interessant daran finde ich, dass man
seinen Alltag wie ein hypochondrischer Buchhalter zu inventarisieren beginnt. Gibt es eine Parallele
zwischen dieser auf Essen fixierten Verbuchung von Lebenszeit zu unserem 21. Jahrhundert?
Seit 40 Jahren spricht man vom Hunger in der Welt, von Menschen, die nichts zu essen haben. Heute geht es um
genetisch manipulierte Nahrungsmittel, um Kreationen aus Chemielabors, um den Niedergang der französischen
Gastronomie. Die Titelseiten der Zeitungen sind voll davon. Jeden Tag liest man von neuen Diäten und
Nahrungsunverträglichkeiten. Wir sind von diesen Themen umzingelt. Ein diffuses Leiden an komplizierten
Fragen des Zusammenlebens und der Identität macht sich breit. Wir befinden uns an einem Punkt, der
Veränderungen notwendig macht. Gleichzeitig ist Frankreich gelähmt von einer Reformstarre. Vielleicht
erzählt unser Umgang mit Nahrungsmitteln, unsere Fokussierung auf Fragen der Ernährung, unsere Jagd nach
Genuss um jeden Preis, unsere Listen von weltbesten Restaurants viel von unseren Ängsten. Vielleicht ist
es eine Art Krankheit, eine Krankheit als Metapher.
Pontormos schreibt dieses Affresco der Körperlichkeit am Ende seines Lebens. In seiner Selbstbeobachtung
wird Welt nahezu ausgegrenzt. Er lebte in einer Gesellschaft im Wandel, es war der Übergang von der
Hochrenaissance zum Barock, politisch eine Zeit vieler Krisen. Interessant daran finde ich, dass man
seinen Alltag wie ein hypochondrischer Buchhalter zu inventarisieren beginnt. Gibt es eine Parallele
zwischen dieser auf Essen fixierten Verbuchung von Lebenszeit zu unserem 21. Jahrhundert?
Eine letzte Frage: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das verschlingende, verinnerlichende Lesen.
Im »Neuen Testament« spricht eine Stimme aus dem Himmel, die Johannes auffordert, sich aus der Hand
eines Engels ein Buch geben zu lassen und es zu verschlingen. Johannes trifft den Engel und spricht
ihn an: Gib mir das Buch. Der Engel sagt: Nimm und verschling’s! Johannes als Libro-Phage, als Buch-und
Schriftverschlinger, der alle Visionen und Auditionen in sich aufnimmt. Kennen Sie die Szene?
In der Apokalypse.
Juni 2014, aus dem Französischem von Stefan Barmann.